Embser Chronik
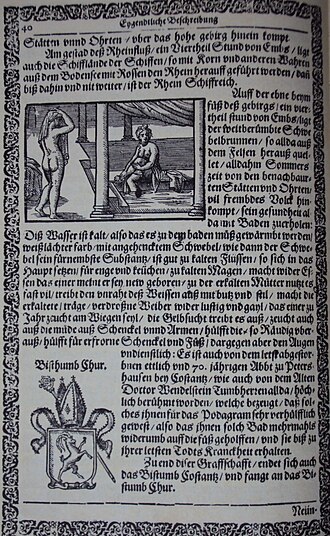
Die Embser Chronik (auch: Emser Chronik) wurde 1616 von Bartholomäus Schnell (* 1580 in Langenargen, † 19. April 1649 in Hohenems) in der Gräflich Hohenemsische Buchdruckerei (1616–1730) in Hohenems gedruckt.[1] Dieses Werk gilt als ein „Meisterwerk der Buchdruckerkunst“ und wurde auch mehrfach als „das schönste je in Vorarlberg gedruckte Buch“ bezeichnet.[2] Ein gut erhaltenes Exemplar der Chronik zählt heute zu den Kostbarkeiten der Landesbibliothek in Bregenz.
Name
Der Name Embser Chronik bezieht sich im ersten Wortteil auf die Stadt Hohenems in Vorarlberg. Der ursprünglich Name der Stadt lautete Ems (Mundart: Embs) und wurde erst im Laufe der Zeit, vor allem durch Burg Hohen-Ems (heute als Alt-Ems bezeichnet) auf dem Schlossberg zu Hohenems.
Chronik bezieht sich auf den Inhalt des Werkes, in welchem geschichtliche Abläufe in Prosa dargestellt sind, wobei aufgrund der vielfältigen Zeichnungen[3], Wappen, Landkarten etc., dieses Werk einen besonderen Charakter erhielt.
Geschichtliche Hintergründe
Die Embser Chronik wurde zum Ruhm und Ehre der Grafen von Hohenems geschaffen und publiziert. Der ursprüngliche Name der Chronik lautete: rhetianische Histori.[4]
Im 16. und 17. Jahrhundert strebten die Grafen von Hohenems zu mehr Macht. Einer der Söhne von Jakob Hannibal I. wurde 1612 Erzbischof (Fürstbischof) von Salzburg (siehe: Markus Sittikus). In diesem Amt löste er seinen Vetter Wolf Dietrich von Raitenau (1559–1617) ab. Bereits zuvor hatte Marx Sittich von Ems durch geschicktes Vorgehen die Macht der Grafen von Hohenems auch auf Reichsebene ausgebaut. Der Auftraggeber der Embser Chronik, Kaspar von Hohenems (* 1573; † 1640), hingegen sorgte erfolgreich für die Festigung des Territoriums in und um Vorarlberg. Dazu gehörte auch, neben dem bereits 1560 vom italienischen Baumeister Martino Longo erbauten und bis heute bestehenden Renaissancepalastes, die Anlage von Gärten, Tiergärten und Fischweihern, 1605 die Erhebung von Hohenems zu einem Markt unter neuerlicher Bestätigung der Stadtrechtsprivilegien von 1333, Einrichtung einer Lateinschule, Förderung des Handels durch Ansiedelung von Juden in Hohenems, Ausbau des Schwefelbads zur viel besuchten Stätte für zahlreichen Adeligen und hohen Geistliche und eben auch 1616 Gründung der ersten Buchdruckerei in Vorarlberg. Bereits 1613 konnte Kaspar von Hohenems die Herrschaften Vaduz und Schellenberg (siehe: Fürstentum Liechtenstein) zur weiteren Machtarrondierung ankaufen. Bereits 1699 musste die Herrschaft Schellenberg und 1712 die Grafschaft Vaduz von Jakob Hannibal III. aus Geldnot an Hans Adam von Liechtenstein wieder verkauft werden.[5]
In einer in der Embser Chronik abgedruckten Landkarte wurde dieser Anspruch der Hohenemser Grafen auf ganz Vorarlberg dokumentiert. Gefordert wurde darin von Johann Georg Schleh für seinen Auftraggeber ein geeintes Land (noch zu schaffendes Fürstentum) zwischen den Grenzmarken Arlberg, Bodensee, Silvretta und dem Rheintal, in dem Rhetianische Lantsart bestehe. Ihre Ansprüche auf das Land führten die Hohenemser Grafen auf ihre angeblichen Ursprünge einer rätisch-etruskischen Abstammung zurück.
Die Pläne scheiterten unter anderem am Widerstand der Vorarlberger Landstände und dem Beginn des Dreißigjährigen Krieges.[6]
Literarische Aufarbeitung der Embser Chronik
Zahlreiche Arbeiten und Untersuchungen wurden in den letzten Jahren auch der alten und neueren Literatur Vorarlbergs gewidmet und so deren Bedeutung und Besonderheit hervorgehoben. "Das älteste gedruckte Buch eines Vorarlbergers, die 1485/86 hei Konrad DINCKMUT in Ulm erschienene "Schwäbische Chronik" des Thomas LIRER aus Götzis[7], fand durch die Neuausgabe von Eugen THURHER entsprechende Würdigung und mittels der umfangreichen Einleitung eine literarische Einordnung und Gesamtdarstellung. Der Autor der Embser Chronik, Johann Georg Schleh, war Hauslehrer der Grafen von Ems.[8]
Hermann Begle
Die Geschichte von Vorarlberg und insbesondere von Hohenems fand in den letzten Jahrzehnten neue historische Aufwertung. Bedeutende Heimatforscher wie Karl ILG, Benedikt BILGERI, Franz HÄFELE u.v.a., haben nach gründlichen Forschungen ein neues, abgerundetes Geschichtsbild der Lande vor dem Arlberg zusammengestellt. Ludwig WELTI hat in zahlreichen Büchern und Beiträgen die Zeit der Emser Grafen neu aufleuchten lassen und ihnen einen gebührenden Platz in der Geschichte Vorarlbergs eingeräumt.
Um so verwunderlicher erschien es Hermann Begle, ehemaliger Direktor der HAK/HAS Lustenau[9], dass dem schönsten und ältesten in Vorarlberg gedruckten Buch, der "Emser Chronik" des aus Rottweil stammenden Johann Georg Schleh[10], der die Embser Chronik 1613 fertiggestellt hat, noch keine eingehende Betrachtung zuteil wurde. Mit seiner Arbeit will Begle versuchen, die entstandene Lücke zu schließen, das Werk genau zu beleuchten und seine Besonderheit hervorzuheben.[11]
Brigitte Truschnegg
Auch für Brigitte Truschnegg, Historikerin an der Universität Innsbruck[12], ist es wichtig, die »Embser Chronik«, den ersten Versuch einer zusammenfassenden und eingehenderen Darstellung der Geschichte Vorarlbergs, aufzuarbeiten. Untersuchungen zum literarischen Umfeld der Schrift hätten aufgezeigt, dass ältere chronikartige Aufzeichnungen zwischen dem 14. und dem 16. Jahrhundert entweder regional eng begrenzt waren (wie etwa die Feldkircher Chronik des Ulrich Tränkle, frühes 15. Jahrhundert) oder lediglich ein einzelnes Grafengeschlecht dokumentierten (wie die Annalen und die Hauschronik der Montforter, 14. bis Mitte 16. Jahrhundert).[13]
Inhaltliche Würdigung
Das Buch wird heute kurzerhand als Embser Chronik bezeichnet und ist in mehrfacher Hinsicht ein äußerst bemerkenswertes Werk. Einerseits stellt es den Beginn des Buchdrucks in Vorarlberg überhaupt dar, andererseits bedeutet es einen später kaum mehr erreichten Höhepunkt der Schwarzen Kunst in diesem Lande und schließlich ist es der erste Versuch einer zusammenfassenden Geschichte Vorarlbergs. Besonders beeindruckend ist auch das beigegebene kartographische Material, v.a. die älteste erhaltene Karte, die das gesamte heutige Vorarlberg zum Inhalt hat sowie das wohl nachträglich zwischen Seite 40 und 41 eingeklebte Faltblatt mit einem Abriss der Hohenemser Kulturlandschaft.
Standorte
Die bibliophile Kostbarkeit ist leider nur noch in wenigen Originalausgaben erhalten. Von diesen wenigen Erstdrucken in der Vorarlberger Landesbibliothek, Kantons- und Stadtbibliothek Vadiana St. Gallen, Archiv der Landeshauptstadt Bregenz, Stadtarchiv Rottweil ist nur das Exemplar im Vorarlberger Landesmuseum vollständig. Es ist auch als einziges mit dem Originaleinband in Golddruck Emser Wappen im Zentrum und Emser Steinbock in allen vier Ecken versehen. [14]
Einzelnachweise
- ↑ Alois Niederstätter: Bemerkungen zur Vorarlberger Landesgeschichtsschreibung nach 1945 (Version vom 4. März 2016 im Internet Archive) (PDF; 195 kB)
- ↑ "Der Beginn des Buchdrucks in Vorarlberg im 17. Jahrhundert" Landesbibliothek 2005.
- ↑ So zum Beispiel eine Badeszene aus dem Schwefel-Bad in Hohenems, welche in der Chronik dargestellt ist (siehe MDZ München Digitalisat, S. 40).
- ↑ Arnulf Häfele, Peter Mathis, Im San Toni, Friedhof und Kapelle St. Anton in Hohenems, S. 25, 38.
- ↑ Günther Meier: Wie das Fürstentum Liechtenstein entstanden ist In: Schweizerisches Nationalmuseum vom 20. August 2024.
- ↑ Die Grafen von Hohenems, Webseite: vol.at, Vorarlberg Chronik.
- ↑ Thomas LIRER: Schwäbische Chronik; hrsg. und eingeleitet von Eugen THURNHER, Bregenz 1964
- ↑ Götzner Heimatbuch, 1. Teil, S. 188
- ↑ „Vielen Dank, Herr Direktor!“ auf vol.at vom 26. Oktober 2015 abgerufen am 9. Jni 2025
- ↑ Johann G. SCHLEH, Webseite: historisches-lexikon.li.
- ↑ Hermann Begle: Die Embser Chronik des Georg Schleh aus Rottweyl, gedruckt 1616 in Hohenembs
- ↑ assoz. Prof. Mag. Dr. Brigitte Truschnegg am Portal der Uni INnsbruck abgerufen am 9. Juni 2025
- ↑ Brigitte Truschnegg: Die Embser Chronik – die erste historische Beschreibung ›Vorarlbergs‹ mit Stilum geschrieben von Johann Georg Schleh, Seite 32ff
- ↑ Embser Chronik